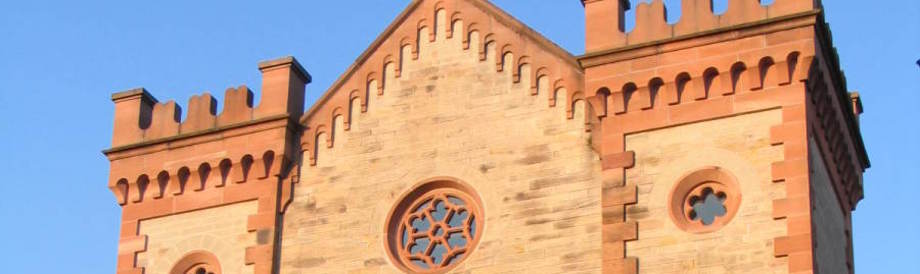
Hermann Maas (1877–1970) – ein „stadtbekannter Judenfreund“
Hermann Maas wurde 1877 in Gengenbach als Sohn des evangelischen Pfarrers Philipp Maas (1848–1911) geboren. Als er ein Jahr alt war, zog die Familie nach Gernsbach, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Nach dem Theologiestudium und dem Vikariat wurde Maas 1915 Pfarrer an der Heiliggeist kirche in Heidelberg. An hohen jüdischen Feiertagen besuchte er den Gottesdienst in der Heidelberger Synagoge. Nach seiner Überzeugung bilden Juden und Christen ein gemeinsames Gottesvolk. 1903 besuchte Maas aus eigener Initiative den Kongress der Zionisten in Basel. Dort kam er mit Martin Buber (1878–1965) zusammen, der in Heidelberg eine Professur innehatte. An der Verbindung mit dem jüdischen Theologen und Philosophen sollte er ein Leben lang festhalten. 1933 unternahm Maas eine mehrmonatige Studienreise nach Palästina. Ihn interessierten Siedlungsmöglichkeiten für Juden, die in das Land ihrer Väter zurückkehren wollten. 1934 trat Maas dem Pfarrernotbund bei und war 1938 an der Gründung der „Kirchlichen Hilfsstelle für evangelische Nichtarier“ (Büro Pfarrer Grüber) beteiligt und leitete dessen badische Zweigstelle.
Wegen seiner Judenfreundlichkeit wurde Maas von den Nationalsozialisten als „Judenpfarrer“ und als „stadtbekannter Judenfreund“ geächtet. Sie übten Druck auf die evangelische Landeskirche aus, ihm die Erteilung von Religionsunterricht und die Predigt zu verbieten. Maas ließ sich nicht einschüchtern. Er half insbesondere jüdischen Christen, um die sich weder Kirche noch jüdische Hilfsorganisationen kümmerten, bei der Auswanderung oder Flucht. Die bei internationalen Begegnungen geknüpften Kontakte kamen Maas bei seinen späteren Rettungsaktionen zugute. Mit anderen Helfern erreichte er die Ausreise von 40 Pfarrern jüdischer Herkunft und zahlreichen jüdischen Kindern nach England.
1944 wurde Maas auf Betreiben der Nationalsozialisten von der Kirchenleitung in den Ruhestand versetzt. Dadurch konnte seine Abschiebung in ein Konzentrationslager abgewendet werden. Anschließend wurde der 67-Jährige zum Bau von Festungsanlagen (Schanzen) nach Frankreich verpflichtet. 1945 unterlag er Julius Bender (1893–1966) bei der Wahl zum Landesbischof. Der Evangelische Oberkirchenrat ernannte ihn zum Kreisdekan (später mit dem Titel Prälat) für den Kirchenbezirk Nordbaden. 1948 besuchte er als badischer Delegierter die Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam. 1950 wurde Maas als erster Deutscher vom Staat Israel zu einem Besuch eingeladen. Er starb 1970 in Mainz.
Die bedeutende Gedenkstätte „Yad Vashem“ in Israel würdigte Maas 1964 als „Gerechter unter den Völkern“ und pflanzte ihm zu Ehren einen Hain. Eine nach ihm benannte Stiftung mit Sitz in Heidelberg fördert Theologiestudenten, die einen Teil ihrer Studien in Israel absolvieren. Sie vergibt Preise an Persönlichkeiten und Einrichtungen, die sich der Verständigung zwischen Christen und Juden verschrieben haben.
Seit 1994 verleiht die Evangelische Kirchengemeinde Gengenbach die Hermann-Maas-Medaille. Diese Medaille sollen Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen erhalten, die sich im Sinne von Hermann Maas „um Verständigung und Versöhnung zwischen Religionen und Völkern – insbesondere zwischen Deutschen und Israelis bzw. Christen und Juden – in Wort und Tat bemühen“. 2013 erhielt der Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V. die Hermann-Maas-Medaille.
Dieter Petri
Literatur
Geiger, Markus: Hermann Maas - eine Liebe zum Judentum: Leben und Wirken des Heidelberger Heiliggeistpfarrers und badischen Prälaten. Heidelberg, Ubstadt-Weiher [u.a.] 2016
Riemenschneider, Matthias: Leben für die Versöhnung. Hermann Maas — Wegbereiter des christlich-jüdischen Dialogs. Karlsruhe 1997


