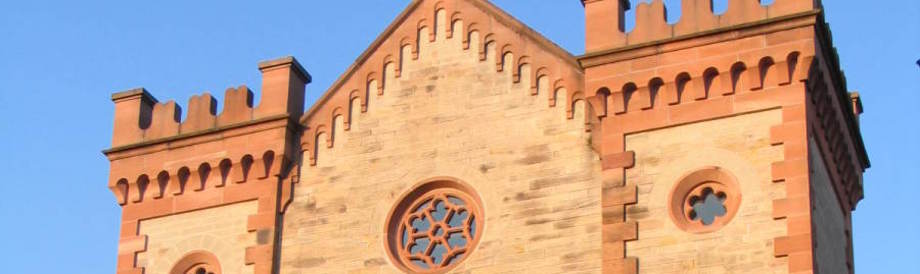
Pfarrer August Schloer - ein „Gegenläufer“
Pfarrer August Schloer(1892-1964) ist es zu verdanken, dass die Schmieheimer Synagoge im Novemberpogrom 1938 nicht zerstört wurde. Seine mutige Tat ist eines der wenigen Beispiele christlich motivierten Widerstands in Baden gegen den Judenhass in der Zeit des Nationalsozialismus. Der 1892 in Grenzach bei Lörrach geborene Sohn eines Zollaufsehers war 1927 mit seiner Ehefrau Klara nach Schmieheim gekommen. Die Kinder Ingeborg Gert, Waltraut, Irmgard und Victor wurden in der Schmieheimer Zeit der Familie geboren.
Schloer war gewiss kein erklärter Antifaschist, bei seinem Entnazifizierungsverfahren 1946 gab er zu Protokoll, er hätte sich um eine Mitgliedschaft in der NSDAP beworben, allerdings nur weil man ihm im Gegenzug versprach, die Schmieheimer Kinderschule weiterhin unter kirchlicher Aufsicht zu belassen: „Als der Kreisleiter in Lahr doch auf die Übergabe an die Nationalsozialistische Volksfürsorge bestand, ging ich in Opposition zur Partei. Ich wurde daher ausgeschlossen auf Beschluss des Gauleiters am 15. Mai 1937.“ Schloer wusste, dass er einen Machtkampf mit dem NSDAP-Kreisleiter Richard Burk (1892–1956) verlieren würde. Möglicherweise war diese Erkenntnis ein Auslöser für seine wiederholten Versuche, Schmieheim zu verlassen. Aus seiner Personalakte lässt sich der Grund für eine im Sommer 1938 erfolgte Ablehnung herauslesen: seine Teilnahme an einer Protestaktion der Bekennenden Kirche gegen die nationalsozialistisch ausgerichtete Finanzabteilung in der Landeskirche. Seine Vorgesetzten, denen anonyme Briefe wegen seines angeblich unangemessenen Lebenswandels vorlagen, warfen ein kritisches Auge auf ihn. Sein Geschick, mit der Jugend umzugehen, wurde zwar mehrfach gelobt, andererseits als Schwäche ausgelegt: „Bei aller Freundlichkeit und Freundschaft im Verkehr mit den Kindern darf aber das Führertum nicht fehlen“, hieß es nach einem Unterrichtsbesuch im Ettenheimer Realgymnasium am 17. März 1933.
Dass er Mut besaß, bewies Schloer bei dem Novemberpogrom 1938, als SA-Männer die Schmieheimer Synagoge stürmen und in Brand setzen wollten. Einer seiner Söhne schilderte 1989 in der Kirchenzeitung „Aufbruch“ die Reaktionen seiner Eltern auf dieses Vorhaben: „Zum Zeitpunkt der Reichskristallnacht war ich gerade neun Jahre alt. Das Entsetzen meiner Eltern und ihre Scham im Hinblick auf unsere jüdischen Nachbarn, als die örtliche und auswärtige SA die Synagoge demolierte und sogar niederbrennen wollte, ist mir heute noch vor Augen.“ Mit dem Ruf „In Schmieheim wird nichts kaputt gemacht“ versuchte der Schmieheimer Bürgermeister Georg Huck die Brandstifter an ihrem Vorhaben zu hindern; ausschlaggebend aber war ein Anruf Schloers bei einem höheren SSMann in Mahlberg. Der Offizier, ein ehemaliger Schüler des Pfarrers, stoppte daraufhin die Brandaktion. Doch drohte neue Gefahr: Am Nachmittag des gleichen Tages versammelten sich Arbeiter einer Ettenheimer Stuhlfabrik am Ortseingang von Schmieheim, mit der Absicht, die jüdischen Geschäfte dort zu plündern. Pfarrer Schloer, Ratsschreiber Wilhelm Meythaler, Besenfabrikant Erich Hiller und andere Schmieheimer traten mit Hacken und Peitschen bewaffnet, den Eindringlingen entgegen und drängten diese aus dem Dorf. Die Schändung der Schmieheimer Synagoge konnte letztlich nicht verhindert werden. In einem Schreiben vom 15. Oktober 1948 an den Oberkirchenrat erwähnt Schloer einen Nationalsozialisten, der „acht Tage nach dem 9. Nov. 38 mit seinem Streifendienst die Schmieheimer Synagoge demolierte und die Heiligen Gesetzesrollen durch den Straßenschmutz zog“. Wohl ebenfalls an diesem Tag wurde der bei Schmieheim gelegene jüdische Verbandsfriedhof heimgesucht und die dortige Leichenhalle angezündet. Schloer versuchte mit einigen Konfirmanden die Flammen zu löschen. Tags darauf richtete er mit Schülern aus dem Ettenheimer Realgymnasium die umgestoßenen Grabsteine wieder auf.
Spätestens nach dem Pogrom war es für Schloer und seine Familie Zeit, Schmieheim und den Landkreis Lahr zu verlassen. Über ein StellenTauschverfahren wechselte er an die Kirchengemeinde HeidelbergSchlierbach. Doch noch kurz vor seinem Wegzug zog er den Zorn der lokalen Nazis auf sich, wie einer seiner Söhne berichtete: „Unsere jüdischen Nachbarn, die Familie Weil, Flora Bloch und Nathan Dreifuß, sahen der Versetzung meines Vaters im Sommer 1939 mit Bangen entgegen. Ich war dabei, als meine Eltern bei Flora Hausrat abkauften, später auch bei Weils. Meinem Vater brachten die Käufe allerdings ein Schmähplakat ein, das eines Morgens an unserer Haustür hing und meinen Vater im Talar und daneben meine Mutter und uns Kinder zeigte mit der Aufschrift: ,Sage mir, wo du deine Möbel kaufst und ich sage dir, wer du bist!‘ Meine Eltern hat ten den jüdischen Nachbarn auf deren dringende Bitte hin Hausrat abgekauft, da diese dringend Geld für die Flucht brauchten“.
Die Heidelberger Spruchkammer stufte Schloer 1946 als Mitläufer ein und verurteilte ihn zu einem Sühnegeld in Höhe von 50 Mark. Empört über diese Entscheidung schrieb er an den Oberkirchenrat: „Jeder, der mich kennt, empfindet das Urteil als hart und ungerecht.“ Mit seinem Handeln hatte er bewiesen: er war kein „Mitläufer“, sondern, wie er sich selbst sah: ein „Gegenläufer“.
Jürgen Stude
Literatur
Hertenstein, W.: Pfarrer August Schloer und die Judenpogromnacht in Schmieheim. In: Aufbruch. Evangelische Kirchenzeitung für Baden v. 09.04.1989
Landeskirchliches Archiv Karlsruhe - LKA KA, PA August Schloer


